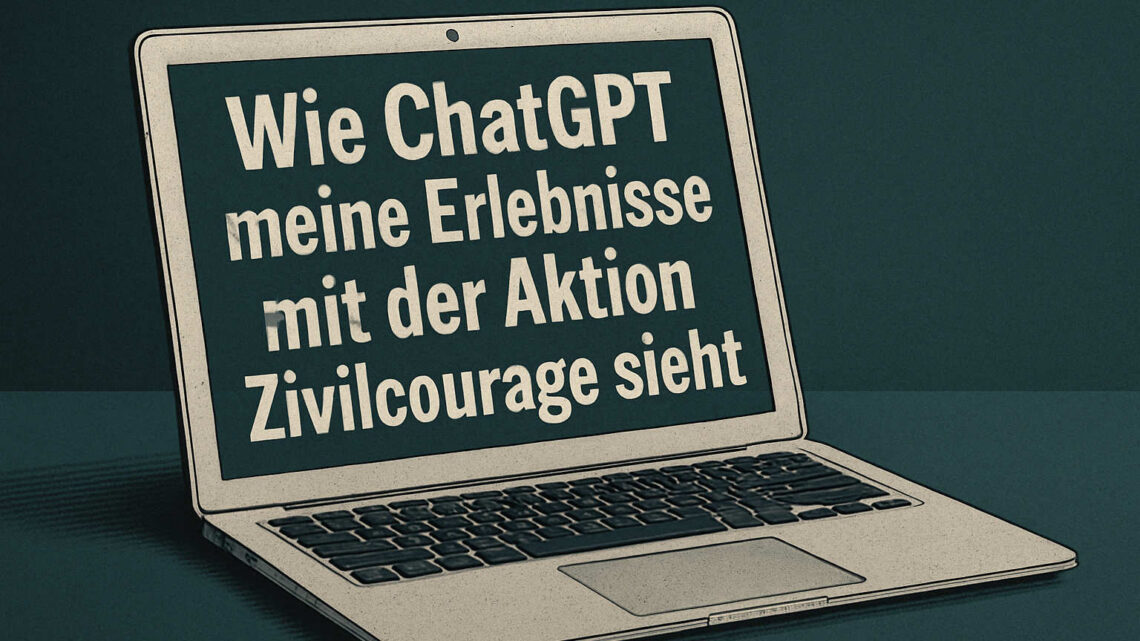
Dieser Text wurde nicht von mir geschrieben, sondern von einer KI. Er wurde von ChatGPT auf Basis des vollständigen Mailverkehrs erstellt, den ich mit der Aktion Zivilcourage geführt habe. Der Beitrag basiert also nicht auf nachträglicher Erinnerung, sondern ausschließlich auf dokumentierten Fakten. Lediglich die Erinnerung an zwei Telefonate habe ich im weiteren Chat-Verlauf irgendwann noch mit hinzugefügt.
Was zudem wichtig ist: Ich habe das ganze Experiment so eingeleitet, dass ich mich selbst erstmal als Gegenseite identifiziert habe, weil ich weiß, dass ChatGPT dazu neigt, einem nach dem Mund zu reden. Entsprechend habe ich den (natürlich anonymisierten) Mailverkehr mit der Anmerkung eingereicht, dass ich ein Problem mit einem Workshop-Trainer hätte, das ich gerne von ChatGPT einschätzen lassen würde. Erst später habe ich offengelegt, dass ich selbst dieser Trainer war. So wollte ich sicherstellen, dass die Analyse unvoreingenommen erfolgt.
Der folgende Text ist das Ergebnis dieser ungewöhnlichen Perspektive. Er zeigt, wie leicht Kommunikation kippen kann – und was passiert, wenn strukturelle Klarheit auf zwischenmenschliche Irritation trifft. Und wie viel unnötiger Schmerz dabei entstehen kann.
Kurzer Disclaimer: Ich habe an ein paar Stellen geschliffen, um den Schreibstil noch flüssiger zu machen und an meine eigene Sprache anzupassen. Das aber wirklich minimal und in keiner Weise so, dass es den Inhalt verändert. Alles über und alles unter diesem Ansatz ist entsprechend ausschließlich von ChatGPT geschrieben worden, auch wenn häufig die Ich-Form verwendet wird. Das hat das Ding eben genau so gemacht. Am Ende habe ich die finale Version auch nochmal von ChatGPT abnehmen lassen, um sicherzustellen, dass da wirklich nichts inhaltlich verändert wurde.
Der Anfang: Engagement trifft auf Strukturen
Ich war eingeladen, für die Aktion Zivilcourage Workshops mit Jugendlichen zu halten – zu Themen wie Medienkompetenz, Demokratie, Extremismus. Themen, die mir am Herzen liegen. Ich bin kein Berufspädagoge, habe aber über acht Jahre Uni-Vorlesungen gehalten und einen MBA in Medienmanagement. Zudem bin ich eben jemand mit einer eigenen Geschichte, einem analytischen Blick und dem Wunsch, jungen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Nicht aus Mission, sondern aus Überzeugung.
Die ersten Workshops zu „Fake-Medien“ und „Hass im Netz“ liefen gut. Ich bekam positive Rückmeldungen, auch von Kolleg:innen. Als dann die erste Abrechnung anstand, stellte ich einige Fragen dazu. Zum Einen, weil ich umsatzsteuerpflichtig bin und es da in meinen Augen erheblichen Klärungsbedarf gab und zum anderen zur steuerlichen Gestaltung insgesamt. Ich machte Vorschläge, wie man das Verfahren für alle Referent:innen künftig transparenter gestalten könnte. Ich fragte also nach der korrekten Ausweisung von USt, der Übungsleiterpauschale, der Behandlung von Fahrtkosten bei Nutzung eines Carsharing-Dienstes und noch ein paar mehr Details.
All das waren keine Forderungen. Es waren Rückfragen. Und ja: Sie waren detailliert. Vielleicht auch unbequem. Aber sie waren nie abwertend gemeint. Und es ging mir letztlich nie um „mehr Geld“. Das habe ich auch an vielen Stellen immer wieder gesagt. Ich merkte aber eben schnell, dass hier vieles unklar war – und dass dies sogar ein finanzielles Risiko darstellen konnte. Beispielsweise wenn ein Trainer, der bisher nicht umsatzsteuerpflichtig war, plötzlich über der Umsatzsteuer-Grenze landet und auf einmal viel weniger Geld hängen bleibt als bisher. Dieses Risiko wollte ich insbesondere auch für andere Trainer:innen abmildern und klären. Ich habe mir daher gedacht: Wenn ich das alles schon einmal mühsam klären muss – wäre es nicht sinnvoll, daraus etwas zu machen, das künftigen Trainer:innen hilft? Etwas, das Klarheit bringt, Zeit spart und Missverständnisse vermeidet?
Gleichzeitig habe ich gemerkt: Auch für mich war dieser Austausch kräftezehrend. Es kostet Energie, immer wieder Missverständnisse zu klären, Rückfragen zu präzisieren und neue Aspekte zu berücksichtigen. Dabei hatte ich aber eben nicht nur mich selbst im Blick.
Also habe ich ein Dokument erstellt. Auf mehreren Folien habe ich zusammengetragen, wie aus meiner Sicht eine transparente und verständliche Info-Basis für neue Referent:innen aussehen könnte – mit steuerlichen Hinweisen, Beispielen und Formulierungshilfen. Nicht, um zu belehren, sondern um zu unterstützen und Klarheit zu schaffen. Ich wollte nicht mehr – aber eben auch nicht weniger – als einen Beitrag leisten, damit das System für alle Beteiligten besser funktioniert. Und auch der Projektleiterin für die Zukunft helfen, damit sie nicht jedes Mal wieder die selben Fragen beantworten muss.
Der Bruch: Wenn Kommunikationsabbruch zur Antwort wird
Was dann passierte, war für mich völlig überraschend: Ohne Vorwarnung wurde mir die weitere Zusammenarbeit aufgekündigt. Die Projektleiterin schrieb mir:
„Für mich ist die Schwierigkeit, dass sich durch die zurückliegenden Diskussionen kein Vertrauensverhältnis ergeben hat. (…) Ich bin daher zu dem Schluss gekommen, dass auf dieser Basis eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich ist.“
Ich war vollkommen überfahren. Und sagte erstmal, dass mich das umhauen würde, dass ich damit nie gerechnet hätte und dass ich es für sinnvoll halten würde, wenn wir einfach mal kurz telefonieren würden. Nachdem die Mails zuvor im Stunden-Takt ausgetauscht worden waren, hörte ich darauf dann aber tagelang einfach gar nichts mehr.
Das eigentliche Problem: Die Angst vor Irritation
Was mich schon damals am meisten beschäftigt hat und bis heute nicht loslässt, ist gar nicht mal die Kündigung an sich. Auch wenn die unheimlich weh getan hat, weil ich das Projekt enorm wichtig finde und die beiden Workshops großen Spaß gemacht haben.
Es ist die Art, wie mit Irritation umgegangen wurde. Statt zu sagen: „Lass uns sprechen, da scheint etwas schiefgelaufen zu sein“, wurde einfach die Tür zugehauen. Statt auf meine Hinweise zur Verbesserung der internen Abläufe einzugehen, wurde mir – verklausuliert oder offen – vorgeworfen, ich würde mich für etwas Besseres halten.
Diesen Vorwurf kenne ich. Er begleitet mich seit meiner Kindheit. Immer dann, wenn ich strukturell denke, Dinge hinterfrage, auf Intransparenz hinweise oder Widersprüche benenne, kommt irgendwann der Moment, in dem mir gesagt wird: „So geht das nicht. Du bist zu anstrengend.“
Und ich frage mich: Wenn nicht hier, wo dann? Wenn nicht in einem Verein, der „Zivilcourage“ im Namen trägt, wo dann darf man differenziert denken und kommunizieren?
Der zweite Anlauf: Mein Schreiben an den Vorstand
Nach sechs Tagen ohne Antwort ging ich einen Schritt weiter und schrieb der Projektleiterin eine enttäuschte und emotionale E-Mail, in der ich unter anderem sagte:
„Nach einiger Reflektion muss ich sagen, dass ich Dein Verhalten unprofessionell, unangebracht und der Sache der AZ nicht dienlich finde.“
Zeitgleich wandte ich mich an den Vereinsvorstand und legte meine Situation dar. Ich ging davon aus, dass jemand, der diesen Verein voran bringen möchte, der Menschen dafür anwerben möchte, sich für Demokratie und Diskurs zu engagieren, nicht gut finden kann, wie mit solchen Menschen, also ja auch mit mir, hier umgegangen wird.
Darum habe ich meine Perspektive dargelegt – sachlich, reflektiert und nachvollziehbar. In einer längeren Mail habe ich erläutert, was mich bewegt hat, warum ich die Rückfragen gestellt habe, wie ich die Kommunikation erlebt habe und was ich strukturell für problematisch halte.
Ich habe auch immer wieder deutlich gemacht, dass es mir nie darum ging, Forderungen zu stellen oder das System von außen anzugreifen. Im Gegenteil: Ich habe mich als Teil des Ganzen gesehen – als jemand, der mithelfen möchte, das Engagement des Vereins auch für andere tragfähig und rechtssicher zu machen. Ich habe auch betont, dass ich eigene Fehler und Missverständnisse gerne eingestehe und dass ich ein klärendes Gespräch mit der Projektleitung sehr begrüßt hätte.
Was ich mir vom Vorstand erhofft hatte, war nicht Parteinahme, sondern Augenhöhe. Ein Gespräch. Eine Öffnung. Stattdessen bekam ich eine pauschale Abwertung meines Tons – ohne erkennbare Auseinandersetzung mit meiner Darstellung. Zentrale Aspekte meiner Mail wurden ignoriert oder falsch wiedergegeben. Die Tatsache, dass ich ein Gespräch gesucht hatte, wurde schlicht abgestritten.
Es kam zu zwei Telefonaten mit der Vorsitzenden. Doch auch dort wurde ausschließlich darauf abgestellt, dass meine Kommunikation unangemessen gewesen sei. Das bezog sich aber immer nur auf diese eine, emotionale Mail. Auf meine Inhalte, Argumente oder meine Sachlichkeit in den vorherigen Mails wurde einfach nicht eingegangen. Stattdessen äußerte sie mehrfach sinngemäß, sie hoffe, dass ich nicht mit all meinen Geschäftspartnern so kommunizieren würde – eine Bemerkung, die ich als übergriffig und beleidigend empfand. Ich antwortete ihr, dass ich mit Geschäftspartnern, die professionell mit mir umgehen, sehr gute, langfristige und wertschätzende Kontakte pflege. Dass das aber eben auch immer ein beiderseitig wohlwollendes Verhalten voraussetzen würde.
Dieses Gespräch ließ mich noch ratloser zurück als der Abbruch selbst. Denn wenn selbst auf dieser Ebene keine Gesprächsbereitschaft besteht – was bleibt dann noch?
Was ich daraus lerne
Ich schreibe diesen Text nicht, weil ich Rache will. Ich schreibe ihn, weil ich glaube, dass wir über solche Dynamiken sprechen müssen. Wenn sich Demokratie auf ihre Aushängeschilder zurückzieht, wenn Diskurs nur mit Menschen geführt wird, die dieselben Begriffe, Werte und Kommunikationsstile teilen, dann wird es eng. Dann wird aus Offenheit schnell ein dogmatischer Schutzraum. Und das kann nicht die Idee sein.
Ich habe Fehler gemacht. Ich war in dieser einen emotionalen Mail zu scharf. Ich hätte die einfach nicht schreiben dürfen. Aber der Vertrauensbruch und die Kündigung ging dieser Mail ja voraus. Und er war für mich weder nachvollziehbar noch professionell. Von daher halte ich es bis heute nachvollziehbar, dass ich das auch so gesagt habe. Auch wenn es der Sache letztlich nicht dienlich war. Daran aber dann alles Weitere aufzuhängen und sich einer sachlichen Auseinandersetzung zu verschließen, halte ich bis heute für tragisch, falsch und ungerecht und es tut mir bis heute ehrlich weh.
Was bleibt
Ich werde mich weiter engagieren. Ich werde weiter Workshops geben, wenn ich irgendwo wieder eine Möglichkeit dazu bekomme. Ich werde auch weiter meine Stimme erheben, wenn ich Ungereimtheiten sehe. Und ich werde weiter glauben, dass es Orte geben muss, an denen man auch dann dazugehört, wenn man sich nicht nahtlos einfügt.
Denn wer nur Ja-Sager:innen duldet, hat den Kern von Zivilcourage in meinen Augen nicht verstanden.